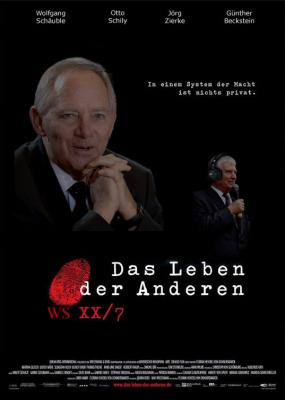Eigentlich habe ich von Harald Martenstein vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört. Diejenigen die mich kennen, wissen, dass ich die Tagespresse
meide wie die Pest nur durch die Blogs der anderen wahrnehme, oder auf Klo gelangweilt den Lokalteil einer der unbedeutensten Zeitungen des Europäischen Ostens durchblättere. Da haben die Kolumnentitel so klingende Titel wie Lützschena oder Markranstädt, jedoch nicht Harald Martenstein. Ich habe ihn vielmehr durch eine
sehr hübsche Sendung M19, das lange Interview des Leipziger Uniradios
Mephisto kennengelernt.
Das Interview fand ich klasse, auch den Typen fand ich klasse aber irgendwie störte mich was, ich wusste nur nicht was. Nun hat sich Harald Martenstein im "neuen" Zeitmagazin Leben über die Unmöglichkeit von
Teamwork ausgelassen. Da ich gerade mitten im (bisher recht schleppenden) Versuch eines
Teamworks drin stecke, möchte ich den Thesen Martensteins hier nicht nur widersprechen, sondern auch versuchen die Ursache für unser gegenseitiges Unverständnis zu finden.
Alles fing eigentlich mit einem
folgenschweren Text an, den ich vor mehr als einem Jahr gelesen hatte. Naja, auch das ist unmöglich zu sagen. Fing es nicht auch mit dem stetigen Benutzen der wikipedia an, also weitaus länger als ein Jahr her? Es lag irgendwie in der Luft, die kollaborative Schreibe, das kollaborative Denken. All die vielen in den Geisteswissenschaften grassierenden Sammelbände, bei denen aus den verschiedensten Perspektiven heraus sich eines Themas gewidmet wird, all diese vielen SFBs, die jetzig beliebteste Kunstform universitärer Forschung bei der DFG. Auch bei meinen Debatten mit Freunden, bei denen man sich über Methoden, Phänomene und deren Beschreibung austauschte, hatte ich das Gefühl, die kollaborative Schreibe, das kollaborative Denken liegt in der Luft. Historiker hassen das Wort "Zeitgeist" ich finde jedoch für etwas was keinen benennbaren Ursprung hat, irgendwann anfängt, sehr passend. Deleuze und Guatari nennen es Meute sein, andere wiederum netzwerken, nicht mehr Baum denken, sondern sich entwickelndes Rhizom, keine argumentative Leitlinien, sondern beredte
Uneindeutigkeit, zielloses arbeiten, die Unlust auf das Kategorische, das Dritte, oder das Wiedererstarken des Flüssigen.
Und nun wettert Martenstein gegen das Team und die Möglichkeit der Verteiltheit der Arbeit. Da ich gerade mitten in einem solchen Experiment stecke, kann ich Martenstein nur widersprechen. Kollaboration ist möglich, auch wenn man, wie Martenstein Texte verfassen muss. Nur muss man kollaborativ sozialisiert sein, kann sich dabei keine egomanen IchMacheAllesNurSoWieIchEsDenke Motivationen erlauben. Und muss darüber hinaus auch Räume für ein Netzwerk erschliessen können und bespielen wollen. Denn nur die Empathie, das mit den Anderen Denken und wie ich es einmal formuliert habe: "Jeder macht was er kann, was er nicht macht, macht er nicht." bringt die wirklichen Teams zustande, unorganisiert, und nur durch eine gemeinsame Intension strukturiert, keine Hierarchien. Ein empatischer Darwinismus quasi. Teamwork Herr Martenstein, möchte ich da ausrufen, ist möglich, aber sicher eine Frage der Arbeitsweise. Denn die im Netz sozialisierten bringen auch die nötigen soft skills mit, um netzwerklich zu arbeiten.